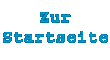|
Vom Werfen mit (elektronischen) Rosen. Oder: Vom
Brief zum SMS.
von Nikola
Herweg
„Ich wollte lieber mit Rosen nach Ihnen werfen,
als ihnen schreiben ...“, versicherte Friedrich Gottlieb Klopstock
am 5.6.1751 in einem Brief an Meta Moller, und schrieb ihr dennoch
immer wieder. Die Angesprochene säuselte zurück „O
Sie sind mein süsser Klopstock“. Das ging so fort, bis
die beiden sich verlobten, heirateten und hörte auch danach
nicht auf, erst als der Tod sie schied (was leider schon bald der
Fall war). Eine Liebe in Briefen mit einem kuriosen Beginn: Die
junge Meta las (auf dem Abort sitzend) den Messias (1748-1773),
Klopstocks umstrittenes Epos (welches man hier zu Toilettenpapier
umfunktioniert hatte), entflammte spontan für Werk und Autor,
schrieb jenem, was nun wiederum ihn entflammen ließ usw.
Ja, so war es, das 18. Jahrhundert, voller Liebesgeschichten in
Briefform, fiktiver wie realer, und dazu gespickt mit jeder Menge
Freundschaftskult. Ein Brief war es auch, der im August 1794 die
Freundschaft und Zusammenarbeit Schillers und Goethes einleitete.
Das 19. Jahrhundert stand seinem Vorgänger übrigens in
nichts nach, auch hier Briefe, die Lebensbünde und -freundschaften
begründeten oder aber beim ersten persönlichen Zusammentreffen
zu einer Enttäuschung führten.
Das 18. und 19. Jahrhundert als die Jahrhunderte des subjektiven,
persönlichen Briefes sind Vergangenheit; die meisten heute
geschriebenen Briefe dürften wohl geschäftlicher Art sein,
und die Verfasser der wenigen persönlichen Schreiben wünschen
sicher nicht, dass ihre Zeilen im Freundeskreis herumgereicht oder
gar im Salon vorgetragen werden.
Dennoch, scheint mir, erlebt der Briefkult eine Art Renaissance:
Letztens war ich auf eine Hochzeit geladen. Die Wurzel des freudigen
Ereignisses lag im Internet. Via Chat hatten sie, als Hamlet, und
er, als Orphelia, sich kennengelernt. Erst wurde im „öffentlichen“
Raum getalkt, später auf e-mail umgestiegen, und noch vor dem
ersten Sehen war der Funke übergesprungen - ganz klassisch.
Dies ist nicht die einzige Internetliebe von Bestand. Andere wiederum
zerrinnen in den Datenhighways, aber alle haben sie gemein mit den
Briefbekanntschaften vergangener Jahrhunderte, dass man sich in
ihnen lösen kann von räumlichen Zwängen und Rollenmustern
- so wie meine Bekannten oder wie Dorothea Veit und Friedrich Schlegel
200 Jahre zuvor.
Vieles hat sich aber auch geändert, die Sprache zum Beispiel:
im elektronischen Medium schreibt man schnell, im Umgangston, auf
Form wird wenig Wert gelegt. Das war - wenn man von einigen Schreibern
(wie etwa Christiane von Goethe) absieht, in den stilisierten Briefen
der Briefblütezeit anders. Auch sind die heutigen Zeugnisse
wachsender Freundschaft oder Liebe vergänglich, wer protokolliert
schon einen Chat im Internet oder druckt seine e-mails aus?
Alles geht nun schneller und während der Briefkult sich etliche
Jahrzehnte hielt, kommt das Chatten bereits wieder aus der Mode.
Der SMS ist da, Handys in jedermanns Hand und schon sind auch die
„Clubs“ geschaffen, in denen man fremde SMSler kennen
lernen kann. Da das Tippen auf den Mobiltelephonen umständlich
ist und das Display so klein, begnügt man sich mit Halbsätzen,
Stichworten. Dafür gibt es nun Icons: ein einziger Klick, und
schon hat man ein Herz verschickt oder eine Rose geworfen. Klopstock
wäre begeistert.
|