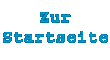 |
|
„Surrogate Cities“ - eine musikalisch - programmatische Auseinandersetzung mit dem Lebensraum Stadt. von Klaus-J. Frahm
„Meine Intention war ... die Stadt als Text zu
lesen und einige ihrer Mechanismen und ihrer Architektur in Musik
zu übersetzen.“ Heiner Goebbels hat mit „Surrogate
Cities“ ein Orchesterwerk geschaffen, das auf eindrucksvolle
Weise das Phänomen „Stadt“ von verschiedenen Seiten
musikalisch betrachtet. Es ist eine Darstellung des „Betondschungels“
in all seiner Komplexität, seinen Auswirkungen im positiven
und negativen Sinne. „Die Interview mit Heiner Goebbels (im Januar 2001) Frage: Am Anfang ihrer musikalischen Entwicklung stand das „sogenannte linksradikale Blasorchester". Goebbels: Ja, und zeitgleich auch, das muß man dazu sagen, ein Jazz-Duo mit Alfred Harth am Saxophon, das 12 Jahre anhielt; ich selbst habe Klavier gespielt. Es fing mit Improvisationen über Themen von Hanns Eisler an, aber auch Jazz improvisationen; es gab auch erste szenische Versuche, wir haben vier Schallplatten produziert und waren in vielen Ländern unterwegs. Frage: Ihr Schwerpunkt ist heute die Theatermusik? Goebbels: Nein, das kann man so nicht sagen. Das war biografisch mein erstes Berufsfeld und hat mich sicher auch geprägt. Ich hab das nur Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger Jahre intensiv gemacht. Was ich jetzt mache ist Musiktheater, also eigentlich genau das Gegenteil. Denn Theatermusik bleibt ja in der Regel in einer eher marginalen und illustrativen Rolle. Für eine Inszenierung von Shakespeare, einem vier-stunden Stück, macht man dann vielleicht zehn Minuten Musik und die wird dann auch noch im Umbau gespielt, wenn man Glück hat.... Jetzt suche ich nach Möglichkeiten, wie man die gewaltigen Kräfte, die die Musik hat, in einem theatralen Kontext nutzen kann. Deswegen schreibe ich Stücke, bei denen Musik auch szenisch eine zentrale Rolle spielt. Das sind dennoch keine Opern im strengen Sinn, weil nicht mit dem klassischen Gestus der Opernsänger gesungen wird, sondern es sind Musiktheaterstücke im tatsächlichen Wortsinn, d.h. das Musikmachen der Instrumentalisten wird auf seine szenischen Möglichkeiten und dramatischen Qualitäten hin untersucht und eingesetzt. F.: Da sind also dann die Musiker mit auf der Bühne, wie bei einer konzertanten Aufführung einer Oper. G.: Nein, eben nicht, weil es eben trotzdem Theaterstücke sind. Theaterstücke, in denen sehr viel geschieht, das Bühnenbild eine große Rolle spielt, viel mit Licht gearbeitet wird, und in denen Texte vorkommen. Oft sind auch Singstimmen eingesetzt, aber es müssen nicht unbedingt klassische sein. Ich habe zum Beispiel Musiktheaterstücke gemacht mit afrikanischen Sängern, mit experimentellen Stimmvirtuosen und mit griechischen Sängern und gerade auch mit einer japanischen Musikerin gearbeitet. Ich finde der Reichtum der menschlichen Stimme ist viel größer, als der Ausschnitt, der in der klassischen Ausbildung seine Vollendung findet. F.: Ist den Surrogate Cities eigentlich auch Musiktheater? G.: Es ist zunächst als Orchesterwerk konzipiert, es war ja ein Auftragswerk der Jungen Deutschen Philharmonie und der Stadt Frankfurt zur 1200 Jahrfeier. Ich habe bereits bei der Uraufführung in Frankfurt 1994 versucht den thematischen Aspekt, die Perspektive auf die Großstadt, auch zu inszenieren. Nicht in dem Sinn, dass das Orchester viel agieren mußte, das geht mit einem so großen Apparat natürlich kaum, aber mit vielen Lichteinsätzen und mit Aufbauten, gerade bei den Percussionisten, um auf der Bühne ein großstädtisches, zum Teil auch industrielles Bild, entstehen zu lassen. F.: Das Ganze klingt ja für einen Außenstehenden
sehr gesellschaftskritisch. G.: Ja, aber meine Position ist da nicht so parteiisch.
Natürlich ist mir die Diskussion um die Unwirtlichkeit der
Stä Auch die Offenheit der Konfrontation dort schätze ich. Während man doch, selbst in Zeiten von Internet und Kabelfernsehen, auf dem Lande, glaube ich, viele Dinge nicht mitbekommt und die Geschwindigkeit noch eine andere ist. Auch die Produktivität, die durch eine kulturelle Auffächerung möglich wird - wie sie in der Bevölkerung Frankfurts stattgefunden hat in den letzten dreissig, vierzig Jahren: diese nicht als Bedrohung zu empfinden, sondern als Bereicherung, das ist der große Vorteil der Stadt. Die erschütternden Übergriffe gegenüber Ausländern finden eben nicht da statt, wo viele Menschen anderer Kulturen und Religionen leben, sondern eher in den Gegenden, wo diese isoliert sind. Wenn die Ausländerfeindlichkeit nicht ohnehin für etwas ganz anderes steht, was ich eigentlich vermute... F.: Wen sprechen Sie mit ihrer Musik denn eigentlich an, wen wollen Sie erreichen? G.: Zunächst ist es eine Komposition, die versucht Erfahrungen durch Stadtbilder mit dem Publikum zu teilen. Es ist nicht eine 'message', die ich habe. Es sind akustische Blicke auf die Stadt; sehr lebendige, sehr unterschiedliche. Eine vielfältige, sowohl in die historische Tiefe, als auch in die Gleichzeitigkeit gehende musikalisch-szenische Umsetzung von Stadterfahrung, Architektur, Geschichte. Ich habe kein bestimmtes Publikum im Blick und die Erfahrung mit dem sehr unterschiedlichen Publikum der verschiedenen Aufführungen war beeindruckend. Natürlich kennt das Publikum in Frankfurt und Berlin meine Arbeiten . Aber schon in Paris, wo die französischer Erstaufführung im Theatre Champs Elysee stattfand, kamen über 1000 Leute, die meine Arbeiten nicht kannten und trotzdem damit etwas anfangen konnten. Überraschend war die Erfahrung dort, wo 'Surrogate Cities' ins Abonnement genommen wurde und das Durchschnittsalter bei 65 bis 70 Jahren lag, auch positiv. Es ist kein auf eine kleine Nische oder ein kundiges Szene-publikum bezogenes Werk, sondern es ist etwas, was trotz der Konkretion der Klänge und trotz der Rabiatheit der Geräusche, die es ausmachen, vermittelbar ist und einen allgemeinen Zugang erlaubt. Sehr starke Reaktionen gab es auch in den Vereinigten Staaten, wo im vergangenen Jahr die amerikanische Erstaufführung stattfand, in Charleston, South Carolina, auf dem Spoleto-Musik Festival. Also offenbar findet man einen Zugang zu dem Stück, obwohl es zeitgenössische Musik ist. F.: Es gibt ja auch sehr populärmusikalische Elemente darin. G.: Ja, zum Beispiel auch Songs mit einer popmusikalischen Struktur. Es gibt viele literarische Quellen für diese Arbeit, Texte von Kafka etwa, die so als Texte nicht vorkommen in dem Stück, aber die mich angeregt haben. Auch Texte von Paul Auster und aus dem Roman "Surrogate Cities", nach dem ich die Komposition benannt habe, von Hugo Hamilton, einem Iren, der das Buch als Fremder in Berlin geschrieben hat. Zwei amerikanische Sänger, die beide in Berlin leben, singen auf dem Album: David Moss, ein unglaublicher Stimmakrobat, und die Soulsängerin Jocelyn B. Smith. Die CD „Surrogate Cities“ ist bei ECM-Records, Köln erschienen. Artikel, Interview und Fotos von Klaus-J. Frahm |
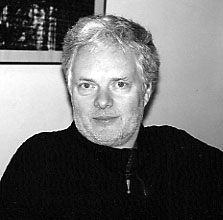 optische
Umsetzung des Themas ist für mich genauso wichtig, wie die
musikalische,“ sagt Goebbels, der aus Neustadt an der Weinstraße
stammt.
optische
Umsetzung des Themas ist für mich genauso wichtig, wie die
musikalische,“ sagt Goebbels, der aus Neustadt an der Weinstraße
stammt.  dte
vertraut. Ich empfinde trotzdem, die Stadt - auch wenn sie nur ein
Surrogat darstellt für etwas, das uns vielleicht einmal vorgeschwebt
hat im Sinne von Geborgenheit, Schutz und Heimat - ist d e r zeitgenössische
Lebensraum; aufregend, fordend, zugegeben. Aber die Städte
bieten auch die Möglichkeit sich dort auf produktive Weise
einzurichten, so, wie ich es ja seit 25 Jahren tue; nicht nur, weil
ich mitten in Frankfurt lebe, sondern auch, weil ich die meiste
Zeit, in der ich unterwegs bin mit meinen Produktionen, mich immer
nur in Großstädten aufhalte.
dte
vertraut. Ich empfinde trotzdem, die Stadt - auch wenn sie nur ein
Surrogat darstellt für etwas, das uns vielleicht einmal vorgeschwebt
hat im Sinne von Geborgenheit, Schutz und Heimat - ist d e r zeitgenössische
Lebensraum; aufregend, fordend, zugegeben. Aber die Städte
bieten auch die Möglichkeit sich dort auf produktive Weise
einzurichten, so, wie ich es ja seit 25 Jahren tue; nicht nur, weil
ich mitten in Frankfurt lebe, sondern auch, weil ich die meiste
Zeit, in der ich unterwegs bin mit meinen Produktionen, mich immer
nur in Großstädten aufhalte.